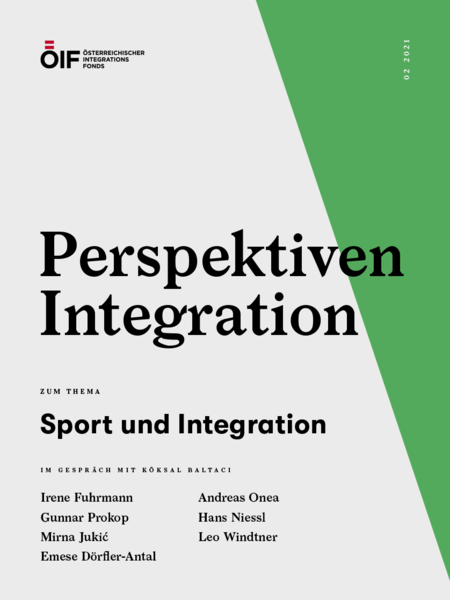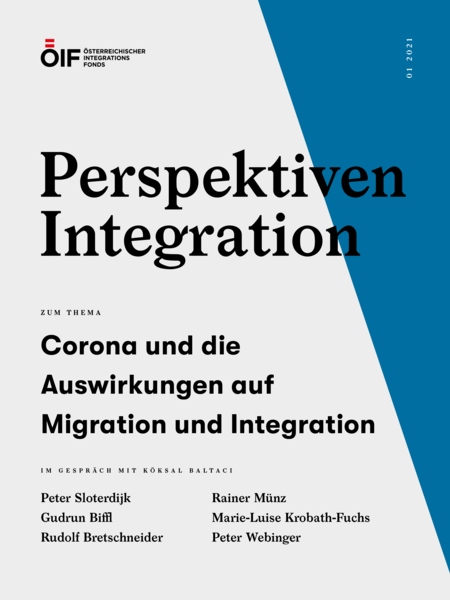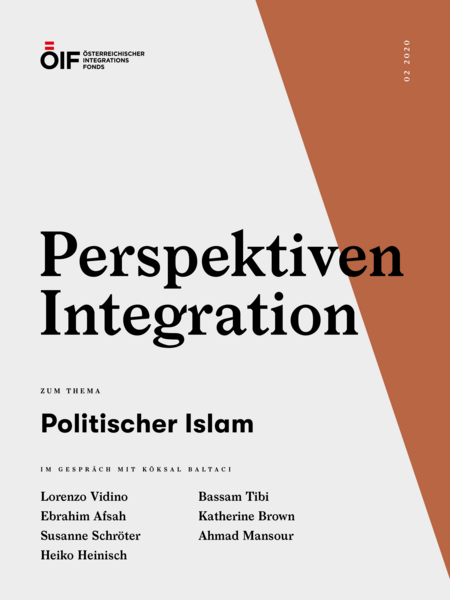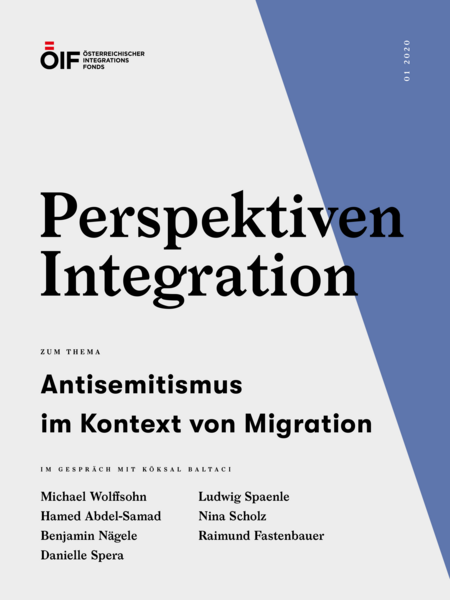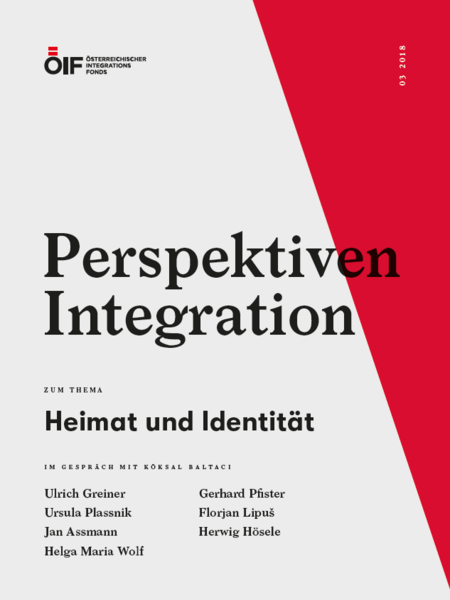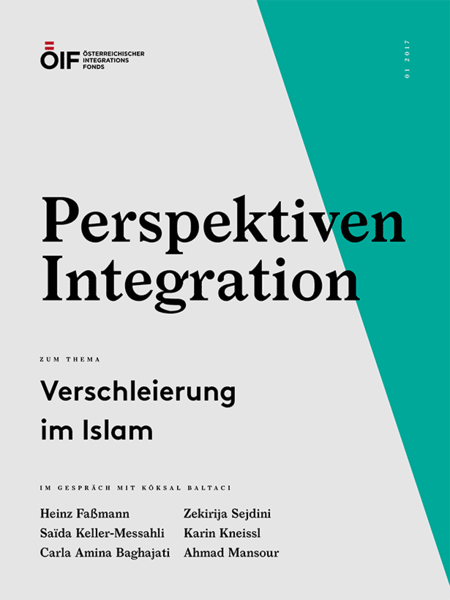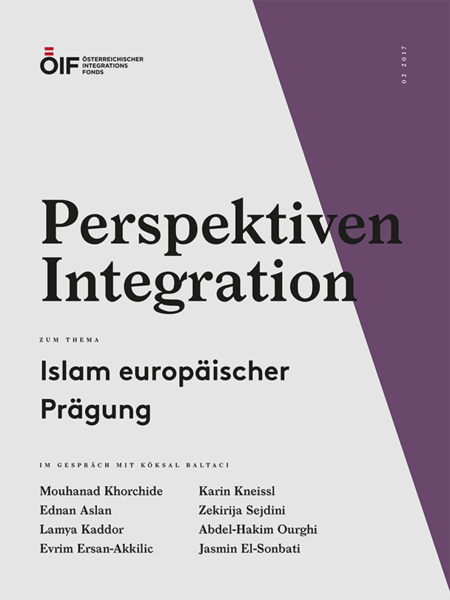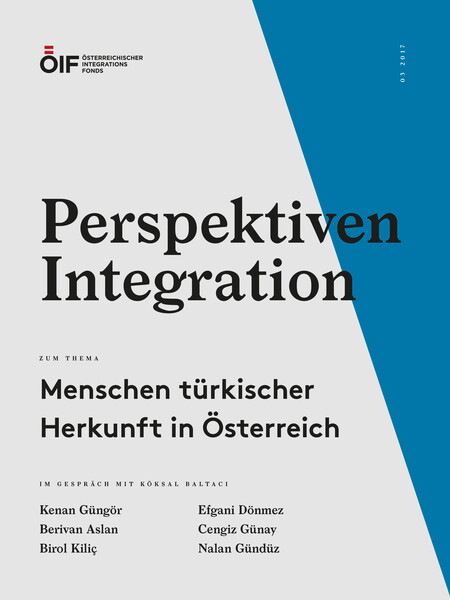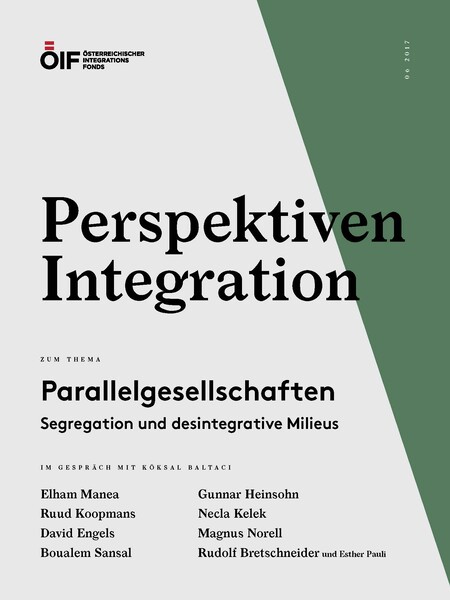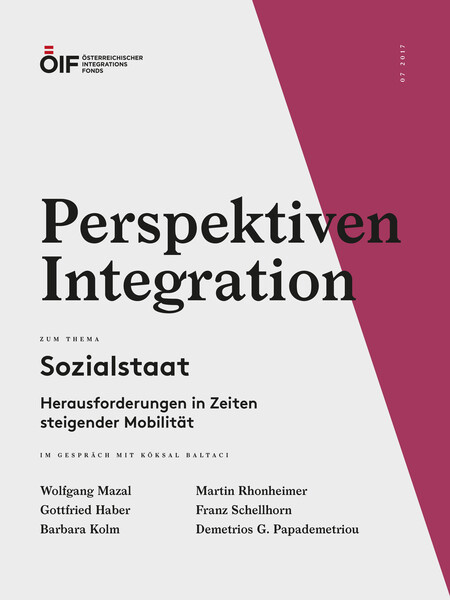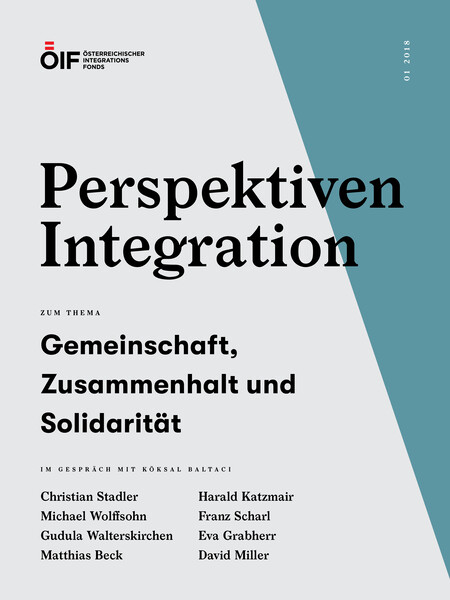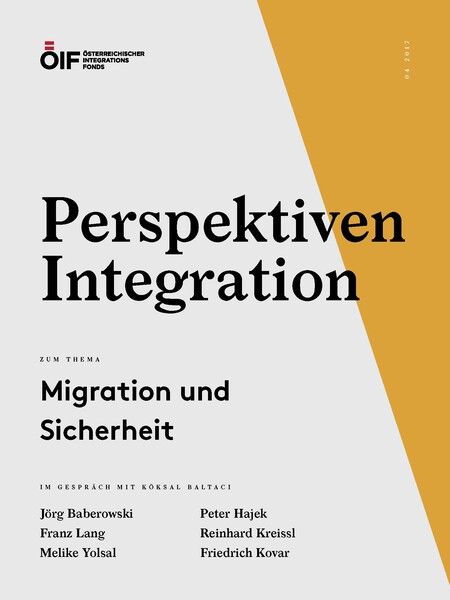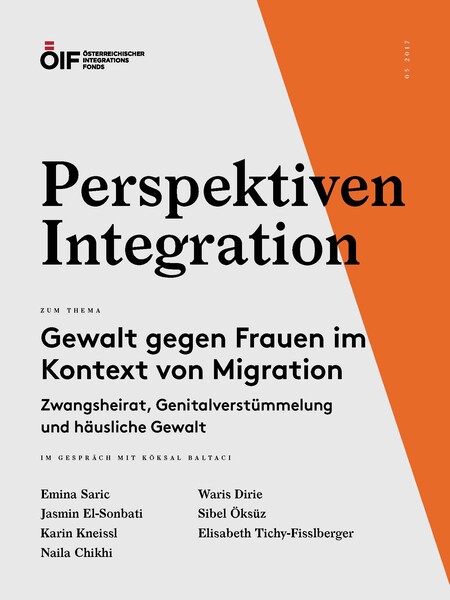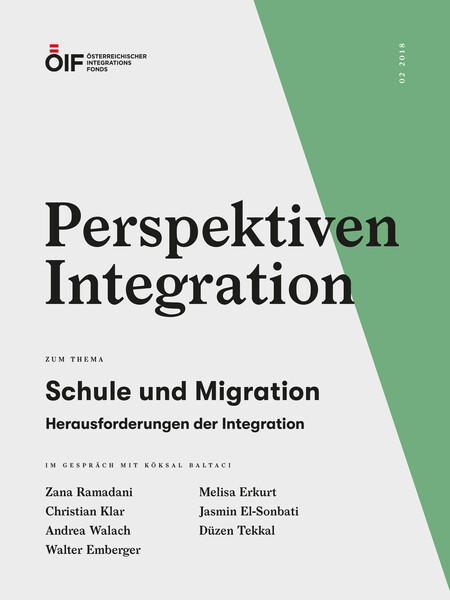08 Gemeinschaft
„Integration benötigt ein Modell der Zukunft, das produktive Rollen für alle imaginiert. Daraus leitet sich Zusammenhalt ab.“
Interview mit Harald Katzmair

Harald Katzmair bekräftigt, dass plurale Gesellschaften nur funktionieren können, wenn es eine starke und vor allem gemeinsame Zukunftsvorstellung gibt. Er hebt hervor, dass Zusammenhalt das Ergebnis einer Wahrnehmung von wechselseitiger Verbundenheit in Kombination mit einem gemeinsamen Richtungssinn ist.
Wie definieren Sie Zusammenhalt in einer Gesellschaft?
Zusammenhalt in einer Gesellschaft ist das Ergebnis einer Wahrnehmung von wechselseitiger Verbundenheit in Kombination mit einem gemeinsamen Richtungssinn, einer gemeinsamen Horizontlinie. Es geht also um ein Grundgefühl, dass etwas Gemeinsames vor uns liegt, wir einen Weg gemeinsam gehen werden, es eine Zukunft gibt, in der wir uns bewähren müssen und wir uns dabei wechselseitig die blinden Flanken abdecken – nach dem Motto: Ich kann etwas, aber ich kann auch etwas nicht, was aber egal ist, weil es den anderen gibt, der das kann. Zusammenhalt ist die wesentliche Voraussetzung von koordinierter Strategie- und Handlungsfähigkeit. Dort, wo der Zusammenhalt verloren ist, zerstreuen sich die Kräfte, die Potenziale können nicht mehr abgerufen werden.
Wann zum Beispiel?
Die Massenpanik ist ein Extremfall von einem zerfallenden Zusammenhalt: Jeder versucht für sich, der Gefahrensituation zu entkommen, jeder versucht, für sich zu überleben und dadurch entsteht überhaupt erst die Katastrophe. Würden die Zuschauer beim Theaterbrand koordiniert den Raum verlassen, gäbe es keine Verletzten.
Was unterscheidet eine nicht-solidarische Gesellschaft von einer solidarischen?
In einer solidarischen Gesellschaft sind sich die Mitglieder bewusst, dass wir alle Zyklen unterworfen sind – wie bei den Jahreszeiten. Es gibt Zeiten, da sind wir im Frühling, voller Kraft und überschießender Energien. Es gibt Zeiten, da sind wir im Sommer, am Höhepunkt unseres Vermögens. Dann jedoch gibt es Phasen des Herbstes, wo wir merken, es geht abwärts. Wo Dinge zu einem Ende kommen und zerfallen. Und dann gibt es den Winter, wo wir uns sammeln und neu aufstellen müssen, um einen neuen Prozess zu beginnen. Eine solidarische Gesellschaft weiß, dass jene, die im Frühling und Sommer sind, jene, die sich im Herbst und Winter befinden, unterstützen müssen. Auch, weil wir wissen, dass auf uns alle irgendwann das Rendezvous mit dem Herbst und Winter wartet.
Von welchen Faktoren hängt Zusammenhalt in einer Gesellschaft grundsätzlich ab?
Dauerhafte Beziehungen und ein Gefühl der Verbundenheit entstehen dort, wo wir das Gefühl haben und auch die Erfahrungen machen, dass wir uns auch morgen und übermorgen und darüber hinaus noch begegnen werden. Es geht also um die Länge des „Schattens der Zukunft“. Wenn wir davon ausgehen, dass eine gemeinsame Zukunft vor uns liegt, wir also gemeinsam Wege gehen werden, verändert sich die Beziehungskultur automatisch. Solange das Gefühl besteht, der andere könnte morgen dann gleich wieder weg sein oder wir könnten den anderen durch feindliche bzw. negative Handlungen „loswerden“, sind Beziehungen fragil und auch nicht von solidarischem Verhalten geprägt.
Sind besonders plurale Gesellschaften, die multikulturell geprägt sind, stärker gefährdet, ihren Zusammenhalt zu verlieren?
Auch plurale Gesellschaften können nur funktionieren, wenn es eine starke gemeinsame Zukunftsvorstellung gibt. Eine Zukunft, in der für alle Beteiligten ein Platz ist. Wenn diese gemeinsame Zukunftsvorstellung fehlt, wenn gemeinsame Zugänge in diese Zukunft fehlen, sind diverse Gesellschaften leichter dafür anfällig, dass ethnische Zugehörigkeiten zu Demarkationslinien werden. Im Sinne des Bildes der Massenpanik von vorhin: Es beginnt dann die Logik des kurzfristigen Überlebenskampfes, auf Kosten anderer.
Welche Ereignisse und Entwicklungen sind typische Beispiele dafür, den Zusammenhalt zu erschüttern? Oder anders gefragt: Was sind erste Anzeichen dafür, dass in einer Gesellschaft der Zusammenhalt verloren geht?
Der Zusammenhalt wird immer dort auf die Probe gestellt, wo Ereignisse stattfinden, die unser existierendes Verständnis der Welt erschüttern. Also überall dort, wo sich die Welt nicht so verhält, wie wir es gerne hätten. Krisen sind ja nichts anderes als eine Situation, wo sich die Welt nicht so verhält, wie wir es erwarten. Krisen stellen Beziehungen auf die Probe. Erste Anzeichen für den Verlust des Zusammenhalts sind: Kurzatmigkeit, Verlust des höflichen Umgangs, Dominanz kurzfristiger Interessen, das Fehlen von gemeinsamen Ritualen wie Geburtstage zu feiern, Musik zu machen, Festtage zu begehen. Auch das Fehlen von Humor und „Schmäh“ sind untrügliche Zeichen, dass eine Gruppe oder Gesellschaft einer Krise des Zusammenhalts entgegenschlittert.
Wie kann man den Zusammenhalt seitens der Politik fördern?
Die Politik kann dafür sorgen, dass es ein gemeinsames Narrativ gibt. Eine Story, in der für uns ein Platz ist, in der wir eine produktive Rolle haben. Wir leben in einer Zeit, in der viele für sich selbst keine wertgeschätzte Rolle sehen oder die Rolle, die sie zurzeit haben, durch Digitalisierung, Migration und Konkurrenz in der Zukunft gefährdet sehen. Solange es darauf keine glaubwürdigen Antworten gibt, wird auch die Erosion des Zusammenhalts fortschreiten.
Und was kann ein einzelner Bürger tun?
Der einzelne Bürger kann für sich selbst prüfen: Was sind für mich selbst Wege in die Zukunft und ist es realistisch, dass ich diese ganz alleine gehen kann? Wie sehr sind wir alle abhängig voneinander, von der Leistung anderer? Wenn wir uns umblicken in dem Raum, in dem wir uns befinden, und uns die simple Frage stellen: Was davon habe ich hervorgebracht? Wenn wir diese Frage ehrlich beantworten, sehen wir gleich, eigentlich ist nichts davon von mir, andere haben es hervorgebracht und damit ermöglicht, dass ich in dieser Form hier sein kann.
Welche Folgen haben die Herausforderungen der Flüchtlingsintegration auf den Zusammenhalt? Gibt es dazu Beispiele aus der Vergangenheit oder aus anderen Regionen?
Die Flüchtlingsintegration stellt zunächst vor allem eine Beziehung auf die Probe: die Beziehung zu uns selber. Wer sind wir, wer wollen wir werden, was sind unsere Werte, was ist uns bedeutsam und wichtig, wer gehört zu diesem „Wir“ und wer nicht, wo ziehen wir die Grenzlinie? Diese Fragen sind noch vor der Frage nach Vergangenheit und Zukunft zu beantworten. In der Vergangenheit war der Flüchtling noch nicht da, daher können wir ihn nicht über die Vergangenheit „integrieren“. Es benötigt eine gemeinsame „Mission“ und „Aufgabe“ in der Zukunft und damit eine Auseinandersetzung darüber, wer wir in Zukunft sein wollen. Die USA und Kanada waren Länder, die Integration über das Zukunftsnarrativ des Aufstiegs und der Verbesserung („American Dream“, „Welcome and make us better“) gestalten. Das aus der französischen Revolution hervorgegangene republikanische Modell war mit der Zukunftsmission von Werten (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) verbunden. Das völkisch-ethnische Modell hat die Besonderheit, dass die Identität über die Vergangenheit und nicht über die Zukunft konstruiert wird. Der „Neue“ muss vollständig in der Kultur einer homogenen Vergangenheit, also Traditionen, assimiliert werden, der „Neue“ kann die Vergangenheit gewissermaßen nicht verändern.
Welche Rolle nehmen die Religion, insbesondere der Islam, sowie unterschiedliche Kulturen dabei ein?
Religionen sind in der Regel gespalten zwischen jenen, die sich über eine rigide Interpretation und Auslegung der religiösen Texte definieren und damit ihre Identität in der Vergangenheit verankern, und jenen Strömungen, die sich der Zukunft öffnen. Dort, wo Religionen sich über Ereignisse der Vergangenheit definieren, ist Integration im produktiven Sinne der Schaffung einer gemeinsamen Zukunft de facto nicht möglich. Vor allem dann, wenn sie auf eine Mehrheitskultur trifft, die dasselbe macht. Das Entstehen einer mehr oder weniger feindlich bestimmten Parallelkultur ist die logische Konsequenz. Hier kommt der wichtige „progressive“ Wert der Liebe und der Vergebung ins Spiel. Werte, die alle Religionen in sich tragen. Es ist die Vergebung, die uns ermöglicht, uns von bitteren Ereignissen der Vergangenheit loszusagen und uns in Richtung einer gemeinsamen Zukunft zu öffnen. Dort, wo Religionen den universellen Pol der Liebe und der Vergebung adressieren, können sie maßgeblich zur Öffnung in Richtung Zukunft und damit zum Zusammenhalt beitragen. Dort, wo sie die „Rache“ und die religionsethnische Zugehörigkeit zu einer Gruppe definieren, werden sie den Zusammenhalt untergraben.
Braucht es für die Integration überhaupt Zusammenhalt in einer Gesellschaft?
Integration benötigt zuerst ein Modell der Zukunft, das Möglichkeiten und produktive Rollen für alle imaginiert. Daraus leitet sich der Zusammenhalt ab.
Und welche Werte helfen dabei, diesen Zusammenhalt zu fördern?
Die Werte, die den Zusammenhalt fördern, sind zeitlos: Offenheit, Neugierde, gemeinsame Kreativität, Empathie. Aber vor allem: vergeben und verzeihen können. Wo Menschen sind, wird es Enttäuschungen, Kränkungen und Verletzungen geben. Wie wir vor allem in Krisenzeiten mit unseren (kollektiven) Enttäuschungen umgehen, entscheidet über Krieg und Frieden – ob wir uns einen Sündenbock als „Opfer“ suchen oder ob wir die „Wunde“ als Auftrag für Entwicklungs- und Veränderungsprozesse betrachten.
Ist die Demokratie derzeit grundsätzlich in Gefahr?
Das Modell der repräsentativ-liberalen Demokratie ist weltweit zumindest angezählt. Das russische Modell einer „direktiven Demokratie“, aber auch das chinesische Modell einer Art „technokratischen Planungsgesellschaft“ gewinnt immer mehr Attraktivität. Es wird an den Kräften des liberalen Modells liegen, zu zeigen, dass es auch andere Formen des Umgangs mit Angst und Komplexität gibt. Das liberale Modell bedarf sicherlich einer grundsätzlichen Weiterentwicklung. Die Konzentration der Macht in den Händen kleiner Gruppen oder Einzelpersonen ist immer ein Zeichen einer großen Fragmentierung und Desintegration. Sie fördert auf Dauer nicht die Lern- und Entwicklungsfähigkeit einer Gesellschaft. Das ist die große Schwäche des Putinschen Modells, es taugt für kurzfristige taktische Gewinne, aber schwächt die gesamte Strategiefähigkeit und Resilienz eines Landes.
Zum Zusammenhalt in Österreich: Was bereitet Ihnen persönlich Sorgen?
Uns fehlt schon seit Jahren ein produktiver Diskurs über die Zukunft, wer wir als „Österreich“ sein wollen, was unsere spezielle Rolle und Aufgabe sein kann. Wir sind mit uns selbst nicht im Reinen, mögen uns selbst nicht besonders und tun uns daher auch schwer mit „Anderen“. Bei aller persönlicher Sympathie für „Nikolaus“, „Skifahren“ und „Wiener Schnitzel“ – sie sind als Leitplanken einfach zu wenig auf unserem Weg in die Zukunft. Ich hoffe noch immer, dass die Migrationsdebatte uns zwingt, endlich „in uns zu gehen“ und ehrliche Antworten auf die offene Frage zu suchen, „wer wir in Zukunft sein wollen“.
Harald Katzmair zählt zu den führenden Experten im Feld der angewandten Sozialen Netzwerkanalyse. Er ist Gründer und Geschäftsführer der FASresearch, einer in Wien ansässigen sozialwissenschaftlichen Forschungsgesellschaft.